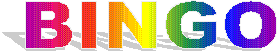
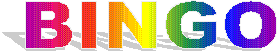
Schecker, Horst Universität Bremen, Institut für Didaktik der Physik
In einem Modellversuch der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung (s. BINGO 1997 und BINGO 1998) werden an einer Bremer Oberstufe Formen des fächerkoordinierten Unterrichts in den Naturwissenschaften erprobt. Jedes Halbjahr steht für alle beteiligten Kurse aus den Fächern Physik, Biologie und Chemie unter einem gemeinsamen fächerübergreifenden Rahmenthema:
Für eine mehrperspektivische Sicht lebensweltlich relevanter Sachverhalte ist es notwendig, Fachleute unterschiedlicher Disziplinen zusammenzuführen. So können in Projekten unterschiedliche Zugänge vernetzt werden, ohne eine fachlich spezialiserte Sicht aufzugeben. Für den Modellversuch lautet die Konsequenz daher "fächerverbindender Unterricht". Das Spektrum fächerverbindender Aktivitäten reicht von relativ kurzen Abschnitten zur Vorbereitung und Durchführung eines Rollenspiels bis zu mehrwöchigen Projektphasen, in denen gemeinsam an einem "naturwissenschaftlichen Museum" zum Thema "Licht und Farbe" gearbeitet wird. Projekte haben bei BINGO eine zentrale Stellung. Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit z.B. die Fähigkeit zum Wechsel zwischen jeweils adressatenbezogenen Sprachebenen - spielen dabei eine wichtige Rolle und orientieren die Schüler auf Schlüsselqualifikationen für ihr späteres Berufsleben.
Die fächerverbindenden Unterrichtsabschnitte werden durch vorhergehenden Fachunterricht intensiv vorbereitet. Zwischen den Lehrkräften werden nicht nur Termin und Inhalt von Phasen mit gemeinsamen Aktivitäten abgestimmt, sondern der Verlauf jeweils eines gesamten Halbjahres, einschließlich der fachspezifischen Vorbereitungsphasen, die bereits auf die notwendigen Beiträge der einzelnen Fächer zum gemeinsamen Projekt bezogen werden.
Die sieben am Modellversuch beteiligten Lehrkräfte der Fächer Biologie, Chemie und Physik arbeiten intensiv bei der Umsetzung der Halbjahresthemen auf die einzelnen Fächer und der Planung der fächerverbindenden Aktivitäten im Verlaufe des Halbjahrs zusammen. Die im voraus erkundeten Verknüpfungsmöglichkeiten werden auf die zu entwickelnden Kurse bezogen und detaillierter ausgearbeitet. Schulinterne Fortbildung der Lehrkräfte hat einen hohen Stellenwert. Nur wenn jede teilhabende Lehrkraft zumindest grobe Informationen über den fachlichen Rahmen der anderen Fächer hat, ist eine fachübergreifende Arbeit sinnvoll. Die Lehrer müssen den Schülern gegenüber eine gewisse Kompetenz auch in den Inhalten der anderen Fächer aufweisen, um die Sinnhaftigkeit fachübergreifenden Arbeitens zu signalisieren.
Die fächerübergreifende Kooperation im Modellversuch wird von den Kolleginnen und Kollegen als erfolgreich und persönlich befriedigend empfunden. Sie wirkt dem bei Lehrkräften verbreiteten Einzelkämpfertum entgegen und wertet zudem den naturwissenschaftlichen Fachbereich innerhalb der Schule auf. Es ist aber festzuhalten, daß ein deutlich erhöhter Zeitbedarf nicht nur für inhaltliche und organisatorische Abstimmungen sondern auch für die Teambildung angefallen ist.
Die Schüler wurden regelmäßig schriftlich nach ihren Einschätzungen des Unterrichts befragt. Zentrale Ergebnisse lassen sich in vier Thesen zusammenfassen (s. dazu BINGO 1997, 149ff. und BINGO 1998, 83ff.):
Als Beleg dient eine Zusammenfassung von Befragungsergebnissen aus allen fünf BINGO-Halbjahren (s. Abb. 1). Darin vergleichen die Schüler den BINGO-Ansatz mit einem "normalen" Unterricht.
Grundsätzlich bekunden die Schüler viel Zuspruch zu fachübergreifendem Arbeiten (s. Abb. 2). Sie nehmen entsprechende Anteile der BINGO-Konzeption jedoch nicht so stark wahr, wie es die Unterrichtsanlage vorsieht. Gleichzeitig geht der konkrete Wunsch nach weiteren fachübergreifenden Anteilen in den BINGO-Halbjahren ab Jahrgangsstufe 12 zurück bzw. gliedert sich nach Befürwortern und Gegnern stärker auf.
Mit zunehmender Laufzeit des BINGO-Unterrichts wird die Kritik an einer zu großen Arbeitsbelastung lauter. Gleichzeitig ist die Grundakzeptanz der Konzeption rückläufig, wofür besonders die Halbjahre 12.1 "Gentechnik" und 13.1 "Medizin und naturwissenschaftlicher Fortschritt" verantwortlich gemacht werden können. Die Bearbeitung einer strikt vorgegebenen Fallstudie (12.1) und eines schriftlichen Beitrags zu einem Patientenratgeber (13.1) finden weniger Widerhall als die stärker praktisch mit der Durchführung von Experimenten und der Herstellung von Exponaten befaßten übrigen Halbjahre.
|
|
Abb. 1: Die Schüler vergleichen BINGO- Unterricht mit "normalem Unterricht"
|
|
|
Abb. 2: Antwortverteilung auf eine offen gestellte Frage nach den Vor- und Nachteilen fachübergreifenden Arbeitens. Es überwiegen zustimmende Stellungnahmen. An anderer Stelle betonen die Schüler jedoch, dass fachübergreifendes Arbeiten keinen zu großen Umfang im Unterricht einnehmen soll. |
|
|
|
|
|