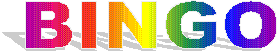
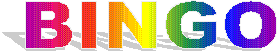
Schecker, Horst (Institut für Didaktik der Physik, Universität Bremen)
Die Durchführung eines Rollenspiels zum Thema "Umgestaltung eines Naturschutzgebietes in einen Freizeitpark" war eines der methodischen Verfahren des Modellversuchs BINGO zur Stärkung fachübergreifenden Arbeitens im Physik-, Biologie- und Chemieunterricht der gymnasialen Oberstufe. Eine der Aufgaben des Modellversuchs besteht darin, Formen der Gestaltung des naturwissenschaftlichen Unterrichts zu erproben, welche die Fachlichkeit aufrechterhalten und gleichzeitig stärkere fachübergreifende Bezüge herstellen. Damit wird eine Forderung des Gutachtens der Expertenkommission zur Weiterentwicklung der gymnasialen Oberstufe aufgegriffen, nach der "komplexe Lehr-Lern-Arrangements" systematisch aus dem Fach heraus und fächerverbindend entwickelt werden müssen (Baumert 1995, 136).
Im Projekt BINGO wird durch einen zwischen den naturwissenschaftlichen Fächern koordinierten Unterricht an gemeinsamen Halbjahres-Rahmenthemen eine Verbindung der physikalischen, biologischen und chemischen Perspektiven angestrebt. Beteiligt sind alle fünf naturwissenschaftlichen Grundkurse des Schülerjahrgangs 1995/96 (2 Biologie, 2 Chemie, 1 Physik). Die Rahmenthemen lauten:
Die Verbindung der unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Perspektiven sowie darüberhinausgehender ökonomischer, politischer und gesellschaftlicher Aspekte erfolgt auf drei Ebenen:
Die beteiligten Lehrer arbeiten auf regelmäßigen wöchentlichen Treffen und Wochenendseminaren bei der Umsetzung der Halbjahresthemen auf Aspektierungen in den einzelnen Fächern zusammen. Dabei findet im Sinne einer schulinternen Fortbildung gegenseitige fachliche Beratung statt. Absprachen bei der Lernsequenzierung und Stoffverteilung sichern den koordinierten Ablauf und die Möglichkeit der Zusammenführung zu gemeinsamen Phasen (s.u.).
Schüler können direkt oder über ein schwarzes Brett Fragen und Antworten austauschen. So wurden bei den Untersuchungen an einem ehemaligen Baggersee von den Biologen Informationen über Ausdehnung und Volumen des Sees angefordert, der von den Physikern vermessen worden war. Die Chemiker steuerten Angaben über die Wasserqualität bei. Gruppen von Schülern sollen auf Anfrage in anderen Fachkursen als "Experten" Auskunft geben. Außerdem ist ein phasenweiser Austausch der Lehrkräfte vorgesehen. Dies wird stundenplanmäßig dadurch ermöglicht, daß vier der fünf Kurse zeitlich parallel unterrichtet werden.
Es werden verschiedene Formen erprobt, wie man die Einnahme fachüberschreitender Perspektiven und eine kritische Reflexion der eigenen fachlichen Perspektive unterrichtsorganisatorisch fördern kann. Der bisherige Stand:
Die fünfwöchige Projektphase fand am Ende des Halbjahrs "Klima der Erde" für alle 5 Kurse zeitlich parallel statt. Die Themen sollten fachübergreifende Aspekte einbeziehen. Gruppen mit Mitgliedern aus verschiedenen Kursen wurden angeregt, von den Schülern aber nicht realisiert. Der Austausch zwischen den Kursen während der Bearbeitungsphase war geringer als angestrebt. Der abschließende Präsentationstag, an dem alle 25 Gruppen ihre Ergebnisse in Postersitzungen vorstellten, führte zu einer stärkeren Anteilnahme an den Arbeiten anderer Gruppen und Kurse. Die Ergebnisse wurden von Jurys bewertet, denen jeweils Lehrer aller drei Fächer angehörten. In die Bewertung ging die Verständlichkeit der Präsentation für Nicht-Fachleute ein (Stichwort "Kommunikationsfähigkeit").
Bei der zweiten auf drei Wochen konzipierten Projektphase (9/96) werden Gruppen mit Mitgliedern aus jeweils drei unterschiedlichen Fachkursen gebildet. Es werden drei halb-offene Aufgabenstellungen aus dem Themenfeld Protein- und Gen-Analyse gestellt, für deren Bearbeitung Kenntnisse aus allen drei Fächern eingebracht werden müssen. Vor dem Projekt liegt eine achtwöchige Erarbeitungsphase, in der die fachspezifischen Kenntnisse vermittelt werden, die für die Projektaufgaben notwendig sind.
Beide Projekte dienen nicht allein der Stärkung fachüberschreitender, bzw. fachübergreifender Anteile sondern auch der Entwicklung sogenannter "Schlüsselqualifikationen", wie "Teamfähigkeit" und "Kommunikationsfähigkeit".
Im ersten BINGO-Halbjahr führten die Schüler ökologische Untersuchungen an einem nahe der Schule gelegenen Baggersee durch, der durch großflächige Anpflanzungen und die Gestaltung von Gewässerzügen und Wegen zu einem naturgeschützten Naherholungsareal umgestaltet worden ist. Die Chemiker analysierten die Wasserqualität und bestimmten z.B. Sauerstoffgehalt, Phosphatgehalt, ph-Wert. Die Biologen führten Artenbestimmungen bei Wassertieren durch, mikroskopierten Mikroorganismen und beobachteten Vögel. Die Physiker vermaßen die Seefläche und bestimmten Profile und Strömungsgeschwindigkeiten in den Abzugsgräben.
Nach Abschluß der Untersuchungen wurde den Schülern das fiktive Angebot einer "Freizeitpark Deutschland GmbH" (FreiPaD) vorgelegt, die das Areal in einen Vergnügungspark mit Tennisplätzen, Wasserski und Badesee umwandeln möchte. Die Gesellschaft beruft sich auf ein ökologisches Gutachten, das die erforderlichen Eingriffe für unbedenklich erklärt. Es wird eine Informationsveranstaltung angekündigt, auf der Experten verschiedener Fachrichtungen das Projekt diskutieren sollen und Bürger Fragen und Kritik einbringen können.
Das Schreiben führt sofort zu heftigen Diskussionen in den Kursen. Einige Schüler vermuten lange Zeit, es handele sich um einen ernstgemeinten Plan. Sofort kommt es zu einer Polarisierung zwischen Befürwortern und Gegnern des Freizeitparks. Es finden sich Schüler bereit, die Rollen von Firmenvertretern, Experten, Diskussionsleitern und Bürgern zu übernehmen. Die Vorbereitung ist sehr intensiv. Es werden Argumente ausgearbeitet, Plakate gemalt, Rollen eingeübt.
Die Veranstaltung findet im Konferenzraum der Schule statt. Auf dem Podium sitzen 9 Schüler und etwa 90 Schüler im Plenum. Sofort beginnt eine hitzige Debatte. Die Bewässerungsexperten auf dem Podium (Physiker) halten das Projekt für undurchführbar, weil der Wasseraustauch, der bei einer Nutzung als Badesee erforderlich wäre, durch die vorhandenen Gräben nicht hergestellt werden könne. Es seien große Pumpwerke notwendig, die das Wasser aus den umliegenden Feuchtgebieten absaugen würden.
Aus chemischer Sicht werden nur geringe Einwände gemacht. Die Wasserqualität sei gut. Allerdings sei bei einem ausgedehnten Besucherstrom mit zusätzlichen Einträgen von Fäkalien zu rechnen, die zu Belastungen führen könnten. Die Pflanzen- und Tierexperten verweisen darauf, daß sie in dem Areal keine gefährdeten Arten gefunden hätten. Bei einer begrenzten Umplanung mit weniger Flächenverbrauch als bisher vorgesehen, ließe sich das Projekt durchaus befürworten.
Es kommt aus dem Plenum zu Protestrufen der Gruppe "Fahrradfahren und Müsliessen": Die Belastung durch anfahrende Besucher sei unvertretbar, da keine Nahverkehrsanbindung gegeben sei. Die FreiPaD meint, daß gerade durch die nahgelegene Autobahn eine optimale Vekehrsanbindung vorliege. Man können sogar eine eigene Auffahrt dafür bauen.
Die Diskussion wird polemischer und macht allen Beteiligten Spaß. Die Argumente entfernen sich aus der naturwissenschaftlichen Sicht und gehen zu Punkten über wie "im Stadtteil gibt es keine attraktiven Freizeitmöglichkeiten". Andere bezweifeln die Wirtschaftlichkeit des Projekts. Die Moderatoren kritisieren, daß zu wenig auf die wissenschaftlichen Fakten zurückgegriffen werde. Die Abstimmung der "Bürger" am Ende ergibt eine klare Mehrheit für den Freizeitpark.
Die Schüler formulierten in einer Hausaufgabe ihre persönlichen Einschätzungen zu dem Projekt und sollten dabei neben den fachlichen Argumenten aus ihrem Kurs mindestens je einen Aspekt aus den beiden anderen Fachperspektiven berücksichtigen. In einem Deutschkurs wird der Argumentationsstil und der Gesamtverlauf der Veranstaltung aufgearbeitet.
Die Schüler-"Experten" hatten sich zu wenig auf eine Argumentation anhand konkreter Meßdaten eingestellt. Sie hegten offenbar Zweifel an der Aussagekräftigkeit ihrer lokalen Messungen. Einzig die Physiker nennen konkrete Zahlenwerte, etwa über Strömungsgeschwindigkeiten in den Abzugkanälen. Es kommt auch niemand auf die Idee, die verwendeten Untersuchungsmethoden zu kritisieren.
Das Rollenspiel fand großen Anklang. Auch nach Abschluß der neunzigminütigen Veranstaltung wurde auf den Fluren weitergestritten. Befragungen aller beteiligten Schüler zu den Halbjahren "Baggersee" und "Klima" ergaben einen großen Zuspruch. Als Gründe dafür nannten die Schüler jedoch weniger die fachüberschreitenden Anteile als die starke Handlungsorientierung und den Lebensweltbezug bei BINGO. Befragungsergebnisse liegen im Vergleich zwischen BINGO-Unterricht und "Normalunterricht" (Sek. I) bei +1,2 auf einer Skala von -2 bis +2. Die Antworten auf Fragen, ob im jeweiligen Kurs Aspekte der anderen naturwissenschaftlichen Perspektiven mit einbezogen wurden liegen dagegen nur um plus/minus Null. Man findet bei den Schülern eine gewisse Reserviertheit gegenüber "fachfremden Inhalten". Der Wunsch nach fachübergreifenden Anteilen liegt auf einer Skala von +2 bis -2 bei +0,5. Hieran ist weiter zu arbeiten.
|
|
|
|
|