Diagnose einer
HIV-Infektion
Unmittelbar nach einer Infektion treten in seltenen Fällen
unspezifische Krankheitssymptome wie Abgeschlagenheit, Fieber,
Schweißausbrüche, Lymphknotenschwellungen,
Appetitlosigkeit, Durchfälle u.a. auf, die nach Tagen oder
wenigen Wochen aber wieder abklingen. Die genannten Symptome
können aber auch auftreten, ohne daß eine HlV-lnfektion
vorliegt. Nur der Arzt kann die Diagnose stellen.
|
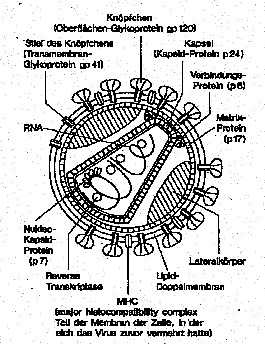
|
Abb. 1: Schematischer Schnitt durch ein Hl-Virus mit den
wichtigsten Struktur- und Enzymproteinen. Die Zahlenangaben
zu den Proteinen und Glykoproteinen, z.B. gp 120, gibt das
Molekulargewicht in Kilo-Dalton an.
In der so gebildeten Hohlkugel liegt eine
konusförmige Proteinhülle und in ihr eine Reihe
für das Virus wichtiger Moleküle: zwei
DNA-Moleküle, die genetische Information des Virus,
einige Moleküle eines Enzyms, der sog. reversen
Transkriptgase, und weitere kurzkettige Strukturproteine,
deren Bedeutung z.T. noch unbekannt ist.
|
|
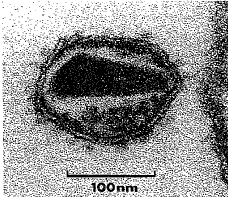
|
Abb. 2: Elektronenmikroskopische Aufnahme von Hl-Viren
(GELDERBLOM, Robert-Koch-lnstitut, Berlin)
|
3 Wochen bis 4 Monate nach einer Infektion lassen sich mit einem
hochempfindlichen Suchtest (ELISA-Test) Antikörper im Blut eines
Infizierten nachweisen. Das Ergebnis wird dann mit einem
Bestätigungstest, dem sog. Western Blot
abgesichert. Bei diesem Test werden im Labor gewonnene Proteine der
Virushülle und des Viruskerns im elektrischen Feld zunächst
aufgetrennt. Dazu werden sie durch Überschichtung einheitlich
geladen und wandern dann im Elektrophorese-Gel, je nach
Größe verschieden weit, die kleineren schneller als die
großen.
Anschließend werden die räumlich getrennt auf dem Gel
liegenden Proteine, ebenfalls auf elektrischem Wege, auf ein
spezielles Nitrozellulose-Papier übertragen (engl. wird dieser
Vorgang ,blotting', etwa Abklatschen, genannt, was dem Verfahren
seinen Namen gegeben hat). Das Papier kann danach in Teststreifen
zerschnitten und mit dem Serum eines Getesteten in Kontakt gebracht
werden.
Die auf dem Streifen befindlichen Hl-Virusproteine wirken als
spezifische Antigene, an denen ggf. die entsprechenden
Antikörper des Infizierten binden. Nun wird der Teststreifen,
wie beim ELISA-Test, mit einem zweiten Antikörper (gegen bei
jedem Menschen vorhandene Immunglobuline), an den ein Enzym gekoppelt
ist, in Kontakt gebracht, so daß sich ein ,sandwich' aus
HlV-Antigen und spezifischem Antikörper aus dem Infiziertenblut
und dem zweiten Antikörper mit konjugiertem Enzym bildet. I
Wird nun Substrat zugegeben, so kommt es zu einer Anfärbung
der Zonen des Testpapierstreifens, an denen es zu einer
Antigen-Antikörper-Reaktion gekommen ist. Vergleichsstreifen
ermöglichen dann die Identifizierung der Antikörper aus dem
Blut des Getesteten. Als sicherer Nachweis für das Vorliegen
einer HlV-lnfektion gilt, wenn Antikörper gegen die
Virusproteine p24 und gp41 oder gegen p24 und gp120 gefunden
werden.
(Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(Hrsg.): AIDS, Unterrichtsmaterialien für die gymnasiale
Oberstufe. Köln 1992, S.36 u. 66.)
Western Blot
Verfahren
1. Herstellung des Teststreifens
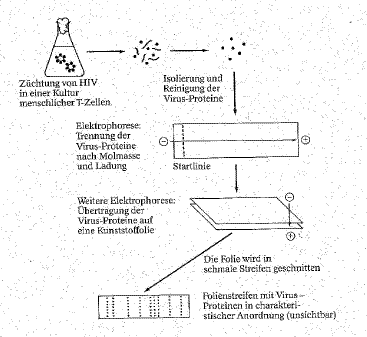 Abb.
3: Abklatschen, "Blotting"
Abb.
3: Abklatschen, "Blotting"
2. Blutaufbereitung
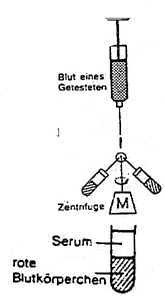 Abb.
4: Blutaufbereitung
Abb.
4: Blutaufbereitung
3. Testreaktion
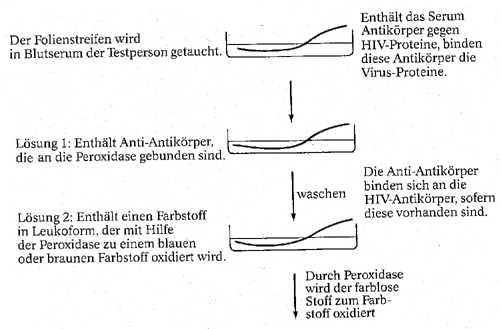 Abb.
5: Testreaktion
Abb.
5: Testreaktion
4. Testergebnis
|

|
Abb. 6: Testergebnis: positiv
|
Quellen der Abbildungen 3 bis 6 bearbeitet aus:
- Biologie heute SII, Lehrerhandbuch für den
Sekundarbereich II, Bd.1,S.268, Hannover: Schroedel 1990
- Bundeszentrale f.gesundheitl.Aufklärung,Köln
1992,AIDS,Unterrichtsmaterialien für die gymnasiale
Oberstufe,S.66
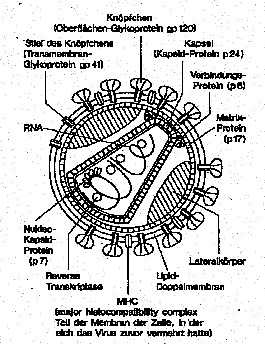
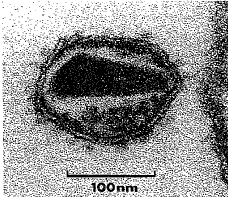
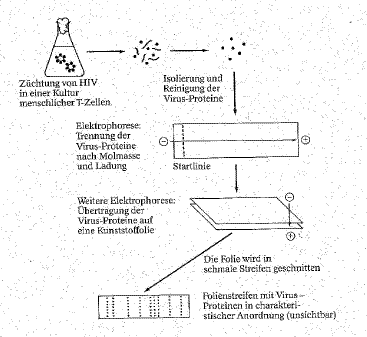 Abb.
3: Abklatschen, "Blotting"
Abb.
3: Abklatschen, "Blotting"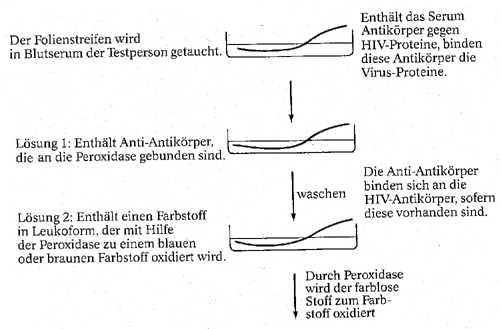 Abb.
5: Testreaktion
Abb.
5: Testreaktion